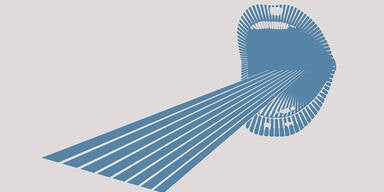Sprache beeinflusst, wie wir die Welt wahrnehmen. Warum man im Sinne einer gleichberechtigten Gesellschaft also auch eine neue Form des Sprechens finden sollte, erklärt Journalistin Kübra Gümüsay.

Die letzten Wochen standen ganz im Zeichen der #blacklivesmatter Proteste und somit einer Bewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt. Inwiefern sind Rassismus und Diskriminierungen aber auch in unserer Sprache verankert?
Kübra Gümüsay: Rassismus ist in den unterschiedlichsten Ebenen unserer Gesellschaft verwoben – ob in Kunst und Kultur, in der Politik oder Exekutive, und natürlich auch der Sprache. Im Buch beleuchte ich das am Beispiel des Museums der Sprache, das im Groben aussagt, dass wir immer aus einer bestimmten Perspektive sprechen. Deshalb stellt sich dabei immer die Frage, wer betrachtet wird, wer betrachtet, wer bezeichnet wird und wer sich selbst bezeichnet. Ergo will ich die Frage nicht an einzelnen Worten festmachen, weil es nicht nur um die Grenzen der Sprachen gehen sollte - also welche Worte man nicht nutzen sollte. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Worum es vielmehr geht ist: wessen Erfahrungen finden in unserer Sprache Platz? Wessen Erfahrungen sind unsichtbar? Es gibt dazu das Beispiel aus den USA: in den 60er Jahren gab es noch kein zureichendes Wort für sexuelle Belästigung. Das hatte zur Folge, wie es die Wissenschaftlerin Miranda Fricker beschreibt, das beispielsweise eine Frau, die davon betroffen war, nicht in der Lage war, sich ausreichend dagegen zu schützen. Und der Täter war sich keinerlei Schuld bewusst. Denn es gab sprachlich nichts zwischen Flirt und Vergewaltigung. Erst mit dem Aufkommen des Begriffes wurde diese Erfahrung und dieser gesellschaftliche Missstand sichtbar. So erst lässt er sich besprechen und bekämpfen. Demnach möchte ich diese Frage, die eine sehr große Frage ist, damit beantworten, dass es nicht reicht, gewisse Worte nicht zu benutzen, weil sie eine rassistische Geschichte haben, sondern sich zu fragen, durch wessen Augen man die Welt betrachtet, wenn man dieses oder jenes Wort nutzt. Und für welche Erfahrung, welche Realitäten, welche Menschen es in unserer Sprache noch keine Worte gibt und wie man die Sprache so ausweiten kann, dass alle Menschen in ihr sein können.
Im Englischen gibt es zum Beispiel den Begriff „People of Color“, mit dem sich viele Schwarze Menschen identifizieren können. Ein deutsches Äquivalent scheint nicht wirklich gegeben. Insofern müssen wir daran arbeiten unsere Sprache auszubauen ? Oder geht es eben weit über die Sprache hinaus, was nun zu tun wäre?
Gümüsay: Die US-amerikanische Debatte zum Thema Rassismus ist natürlich sehr viel weiter. Sehr viele der Debatten hier bzw. das Wissen hierzulande ist davon geprägt was Schwarze Wissenschaftler*innen und Autor*innen in den USA erarbeitet haben. Wenn wir uns aber fragen wie wir weitermachen sollen, dann könnten wir an die ersten Tage der Pandemie zurückdenken und uns daran erinnern wie wir mit dieser globalen wie lokalen Herausforderung umgegangen sind. Wie haben Politiker*Innen kommuniziert? Sie haben transparent vermittelt, dass ihre Entscheidungen auf den neuesten Erkenntnissen basieren, die schlussendlichen Folgen der Maßnahmen im Detail aber ungewiss sind. Dass sie also beständig neu justieren müssen. Dass es keine absoluten, perfekten Antworten gibt. Auch Wissenschaftler*Innem., Vertretende aus den verschiedensten gesellschaftlichen Beriechen haben an diesen Diskursen teilgenommen. Alle haben sich gefragt, was sie strukturell tun können, um die Todes- bzw. Infektionszahlen so klein wie möglich zu halten. Warum geht dieser konstruktive, verantwortungsbewusste diskursive Umgang mit gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen nicht auch bei Themen wie Sexismus und Rassismus? Wo alle sich fragen: Was können wir tun, um dem jeweiligen Problem strukturell zu begegnen? Wenn sich alle dessen bewusst wären, dass es keine abschließenden Antworten dazu gibt, sondern einen beständigen gesellschaftlichen Prozess, der sich konstant korrigieren, reflektieren und dann nochmal ausbessern muss. Zudem würde man nicht nur die individuelle Ebene diskutieren, also die Frage „Was kann ich als Einzelperson tun?“, sondern auch die Frage nach struktureller Veränderung in den Fokus stellen. Denn ich halte es für sehr wichtig, dass bei dem Thema Rassismus nicht nur die persönliche Ebene beleuchtet wird, sondern vor allem auch die strukturelle – dort liegen die Ursachen und auch die Lösung.
Sie haben Corona angesprochen – inwiefern denken Sie hat die Krise in der Bevölkerung den Willen nach Veränderung manifestiert?
Gümüsay: Ich habe, zumindest zu Lebzeiten noch nie mitbekommen, dass sich Menschen in der hiesigen Gesellschaft so stark der Veränderlichkeit von Strukturen unseres Zusammenlebens bewusst geworden sind. Wir haben unseren Konsum eingeschränkt. Wir reisen gerade nicht oder nur kaum. Schulen, Universitäten, Kultureinrichtungen, Friseurläden und viele andere Orte wurden geschlossen. Hätte man all diese Dinge, noch einen Tag vor Beginn des Bewusstseins für die Pandemie diskutiert, wären sie als radikal tituliert worden. Und was passiert in dem Moment, wenn Menschen klar wird, dass Strukturen veränderlich sind? Sie sehen vielleicht zum ersten Mal, dass es überhaupt Strukturen gab. In unserem Alltag normalisieren wir alles um uns herum, sodass wir vieles gar nicht mehr wahrnehmen. Der Moment, in dem wir aber merken, dass Dinge veränderbar sind, kann sehr emanzipierend sein. Das macht mir Hoffnung. Denn wenn Menschen sich gesellschaftlicher Strukturen bewusst werden, begreifen sie in weiterer Folge auch, dass diese Strukturen nicht unabänderlich oder „natürlich“ und dementsprechend auf ewig so sein müssen. Die Pandemie hat vielen vor Augen geführt, dass ein anderes Leben sehr wohl auch möglich ist. Auch wenn einige sagen, wie würden gern in ihr altes Leben zurückkehren wollen, wissen doch alle, dass dies nie wieder passieren wird. Die Frage ist, in welche Zukunft möchten wir uns bewegen? In eine ohne Rassismus beispielsweise. Denn er ist keineswegs „natürlich“ - sondern das Produkt einer konstruierten Ordnung und Zerteilung der Menschheit. Dieser Erkenntnisgewinn ist mitunter sicher auch ein Grund dafür, dass Menschen jetzt besonders hellhörig sind und eventuell auch so großflächig die Black Lives Matter Bewegung mitgetragen haben. Viele Menschen haben verstanden, dass es anders geht und fordert also nun, dass es auch anders gehen muss.
Diskurs auf Augenhöhe „Sprache und Sein“ von Kübra Gümüsay ist erschienen bei Hanser Berlin, um 18,50 Euro.